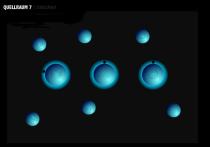EMSCHERplayer // Magazin // Kommunikation und Partizipation // Infrastrukturprojekte und Bürgerbeteiligung
Infrastrukturprojekte und Bürgerbeteiligung
Basta mit Basta?
 05
05
Projekte der Stadt- und Regionalentwicklung scheinen immer und überall von Konflikten bedroht zu sein – ob Flughafen und Infrastrukturtrassen oder Kaufhausneubau und Parkumgestaltung. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger als Risikofaktoren angesehen, deren Protest zum Scheitern führen könnte. Deshalb spricht man nun viel von „neuen Verfahren der Bürgerbeteiligung“ meint aber sehr oft: verbesserte Formen der Durch- und Umsetzung. Geht es auch anders? Sind auch andere, offenere Formen des Umgangs mit Plänen und Projekten denk- und praktizierbar?
Von Stuttgart 21 lernen?
Es ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Und dennoch wirkt der Konflikt um Stuttgart 21 weiter nach. Kein anderes Bauvorhaben im Nachkriegsdeutschland hat die Republik in einem solchen Maße erschüttert. Dieses Beben hat nicht nur die politischen Verhältnisse in Baden-Württemberg und seiner Landeshauptstadt nachhaltig verändert. Es wirkt auch in vielen anderen Städten, in staatlichen Behörden und bei privaten wie öffentlichen Projektträgern nach: Kaum drohen Konflikte, kündigen sich Proteste an, wird strittig diskutiert – schon heißt es: „So etwas wie in Stuttgart darf uns hier nicht passieren“. Passiert „es” doch, bekommt der Ortsname flugs von der Presse ein ’21 angehängt, was sagen soll: Nun haben wir ihn, den größten anzunehmenden Konflikt.
Dabei wird jedoch übersehen, dass viele Projekte auch aus anderen Gründen problematisch werden und scheitern. Vor allem aber geraten bei einer solchen Blickrichtung die Vorhaben selbst aus den Augen. Deren Inhalte scheinen nicht zur Diskussion zu stehen. Sie sind, so wird es gern und oft verkündet: „alternativlos”. Wer die Dinge so sieht, hat nur noch ein Problem: die Umsetzung. Und da scheinen die Bürgerinnen und Bürger im Wege zu stehen. Also will man sie „mitnehmen” und „beteiligen”. Damit das in Zukunft besser gelingt, ruft man nach „neuen Verfahren”.
Womit sich der Blick weiter verengt. Denn eine kritische Befragung bisheriger Verfahrenspraxis unterbleibt so. Etwa danach, ob die Projekte für das Publikum in ihrer Entstehung und Begründung nachvollziehbar waren, ob transparent und ergebnisoffen Alternativen geprüft wurden, ob es tatsächlich relevante Handlungs- und Entscheidungsspielräume gab, ob die möglicherweise Betroffenen rechtzeitig einbezogen wurden etc.
Nein, das alles steht in der Mehrzahl der Fälle nicht (mehr) in Rede. Man spricht von „neuen Verfahren der Bürgerbeteiligung” meint aber sehr oft: verbesserte Formen der Durch- und Umsetzung.
Basta-Planung oder offener Prozess?
Diese etwas zugespitzte Darstellung der aktuellen Diskussion bringt durchaus nichts Neues zutage, sondern verweist lediglich auf ein weit verbreitetes Planungsverständnis, das keinesfalls auf hiesige Projekte beschränkt ist: In einem engeren Kreis von Fachleuten und politisch bzw. ökonomisch relevanten Entscheidern werden alle wesentlichen Grundlagen eines Vorhabens erörtert und vereinbart. Danach geht man an die Öffentlichkeit, teilt mit, was geplant ist und versucht, die Absichten möglichst verlustfrei durchzusetzen. Weil das ein so weit verbreitetes Grundmuster vieler Planungs- und Entscheidungsprozesse ist, gibt es dafür auch schon ein amerikanisches Akronym. Es lautet: DAD, ausformuliert: Decide – Announce – Defend. Erst wird entschieden, dann verkündet, dann verteidigt. Und irgendwann ist Schluss mit der Debatte. Dann heißt es: Basta! So machen wir es jetzt! Das aber gelingt nicht immer. Für den Fall haben humorige Kommentatoren auch schon eine Abkürzung erfunden: „DADA”: Decide, Announce, Defend, Abandon…
Aber es geht auch anders. Auch dafür gibt es bereits eine Abkürzung: EDD (Engage – Deliberate – Decide). Hier gilt es zunächst, alle wichtigen Akteure und Gesichtspunkte zusammen zu bringen, um dann auszuhandeln, was gemeinsam als möglich angesehen wird und erst dann, gestützt auf einen Konsens oder doch eine deutliche Mehrheitsmeinung, Entscheidungen zu treffen. Im Kontext der Stadtentwicklung spricht man in Deutschland auch von „fehlerfreundlicher” oder „lernender Planung” bzw. von „Planung als offenem Prozess”. Deren Prinzipien werden am besten in Karl Gansers berühmtem Satz „Man muss Prozesse gestalten, deren Ausgang man nicht kennt” zusammengefasst.
Etikettenschwindel?
Wer den Stuttgarter Fall kennt, weiß dass es sich da um einen Extremfall des DAD-Modells handelte: Schon fünfzehn Jahren vor dem Ausbruch der massiven Konflikte waren dort alle wesentliche Eckpunkte des Vorhabens ohne öffentliche und offene Prüfung echter Alternativen von einem kleinen Kreis unmittelbar Beteiliger festgelegt und vertraglich vereinbart worden. So ist es nicht überall. Aber den DAD-Grundtypus findet man doch vielerorts, gerade auch bei großen Infrastrukturvorhaben: Aus Sicht der Betreiber steht weder das „Ob” noch das „Wie” grundsätzlich zur Diskussion. Hinter den Hinweisen auf die „Alternativlosigkeit” des Vorhaben und den „Sachzwängen”, die es erforderlich machen, so und nicht anders zu verfahren, verbergen sich miteinander verwobene Interessen und Vorentscheidungen, an denen Forderungen nach Alternativen oder substanziellen Modifikationen des Vorhabens abprallen.
Und so wird das Publikum mit einem bereits festgefügten und als alternativlos apostrophierten Konzept konfrontiert. Es ist dieser Eindruck, dass da etwas über die Köpfe hinweg entschieden wurde und wird, der – in Verbindung mit dem latent vorhanden Misstrauen gegenüber der politischen Klasse und den Entscheidern in den großen Unternehmen – die Stuttgarter Sprengkraft erzeugen kann.
Wenn in Verbindung mit einem solchen Projekt- und Prozessverständnis nun nach „neuen Verfahren der Bürgerbeteiligung” gerufen wird, so besteht der Verdacht des Etikettenschwindels. Denn Beteiligung setzt voraus, dass es noch Handlungs- und Entscheidungsspielräume gibt, dass noch etwas offen ist, an dem man sich mit Aussicht auf Erfolg „beteiligen” kann. Das heißt aber auch: Man kann nicht wissen, wie das Ergebnis der Meinungsbildung mit der Öffentlichkeit aussehen wird.
Beteiligung setzt Handlungsspielräume voraus
Schon Anfang der 1990er Jahre wurde – nicht zufällig in einer Schweizer Untersuchung – kategorisch festgestellt: „Wo Behörden … nicht bereit sind, sich auf das Risiko eines offenen und interaktiven Planungsverfahrens einzulassen, ist auf die Teilnahme der Bevölkerung grundsätzlich zu verzichten.” Und in nahezu allen Handbüchern und Ratgebern, die in den letzten Jahren in großer Zahl zum Thema Bürgerbeteiligung verfasst wurden, heißt es zumeist sinngemäß: „Ein Mitwirkungsverfahren macht nur dann Sinn, wenn die Ergebnisse auch tatsächlich aufgenommen werden können. Es muss ein gewisser Handlungsspielraum bestehen oder herstellbar sein.”
Man mag darüber streiten, wie groß dieser „gewisse Handlungsspielraum” sein muss, um noch als substanziell zu gelten. Aber nicht nur in Stuttgart wird deutlich, dass die Öffentlichkeit ein sehr feines Gespür dafür hat, ob ein echter Dialog oder lediglich eine „Pro-forma-Beteiligung” angeboten wird.
Damit zeichnet sich ein grundsätzliches Dilemma ab: Währen die Bürgerinnen und Bürger Wert auf Wirkung der Mitwirkung legen, also auf substanzielle Erörterungen, die ihren Niederschlag in späteren Entscheidungen finden, sind die Akteure, die Projekte betreiben und über sie zu entscheiden haben, am genauen Gegenteil interessiert: Sie wollen den (nicht kalkulierbaren) Einfluss von Außen möglichst gering halten. Nicht zufällig gilt in gewissen Kreisen daher auch die „Basta-Politik” als Zeichen von Führungsstärke.
Das Fatale an diesem Dilemma ist, dass es sich selbst verstärkt, indem die wechselseitigen Vorurteile stets neue Nahrung erhalten: Die Öffentlichkeit hat ohnehin den Verdacht, dass man sie aus allem heraushalten will und sieht in jeder Schein-Beteiligung neuen Beleg dafür. Dass sie in solchen Fällen schnell das Interesse verliert, überhaupt an Erörterungen mitzuwirken, liegt auf der Hand. So stoßen Projektverantwortliche und Planende oft auf eine aphatisch wirkende Öffentlichkeit, was sie in ihrer Auffassung bestätigt, dass es ohnehin kein Interesse an Beteiligung gibt. Ist das einmal anders, regt sich Widerstand, wird er gar laut – scheint das wiederum Bestätigung dafür, dass man „mit denen ja ohnehin nicht vernünftig reden” kann.
So geraten manche Projekte, die großen und gewichtigen zumal, schnell auf Kollisionskurs mit einer auf Dialog und Verständigung ausgerichteten politischen Kultur.
Es bedarf keiner neuen Verfahren sondern eines Wandels der politischen Kultur
Die Forderung nach echten Handlungsspielräumen als Voraussetzung für jede Beteiligung ist also nicht nur ein „technisches” Kriterium, sondern beinhaltet in Wahrheit den Anspruch auf weit reichende Veränderungen: Basta mit Basta, so könnte eine Kurz-Formulierung für diese Neu-Ausrichtung lauten. Aber noch hat sich wenig in dieser Richtung geändert. „DAD” dominiert. Die vielen Versprechungen, daran etwas ändern zu wollen, sind bislang – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht eingelöst worden.
Zwar wird von „Beteiligung” gesprochen. aber sie ist (vielfach) nicht gemeint. Ein Beispiel: Am 19. Mai 2011 meldete die dpa, dass die Deutsche Bahn nach eigenem Bekunden „bei der Errichtung von großen Bahn-Infrastrukturprojekten zunehmend auf Barrieren in der Öffentlichkeit” stoße. Dazu gehöre neben Stuttgart 21 der Rheintal-Korridor, die Fehmarnbelt-Querung, aber auch die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München und so fort. Bahnchef Rüdiger Grube habe sich dazu auf einem Eisenbahnkongress in Münster wie folgt geäußert: Es müsse gelingen, die Wichtigkeit dieser „dringend notwendigen Netzausbauten in Europa” besser zu kommunizieren. „Meine Linie ist ganz klar: Mehr Beteiligung und nicht weniger Beteiligung. Mehr Kommunikation. Mehr Transparenz. Wir haben doch nichts zu verstecken”.
Die Maßnahmen an sich stehen nicht zur Diskussion. Es geht darum, sie besser zu „kommunizieren”. Das Beteiligung zu nennen ist, siehe oben, Etikettenschwindel. Und ein „Mehr” von dieser Art „Beteiligung” wäre kontraproduktiv: So wird die Spirale wechselseitiger Vorurteile eher noch schneller in Schwung gebracht.
Gefordert ist also nicht in erster Linie eine Veränderung der Verfahren sondern ein Wandel der politischen Kultur.
Erste Schritte: Mehr Transparenz und unabhängige Information
Zwei Missverständnisse könnten in diesem Zusammenhang auftreten, die es zu vermeiden gilt: Wenn im Sinne des oben zitierten schweizer Grundsatzes auf „Beteiligung” zu verzichten ist, weil es keine substanziellen Entscheidungsspielräume mehr gibt, so heißt das natürlich nicht, dass über solche Vorhaben nicht zumindest sehr sorgfältig informiert werden muss: Eine bessere Erläuterung der Projekte und ihrer Hintergründe, eine Information, die aufklärt und erklärt wäre schon ein Gewinn. Schon das unterließ man in Stuttgart über sehr lange Zeit.
Andernorts ist das anders. Dort wird „informiert” und „kommuniziert”. Aber schaut man sich diese Aktivitäten genauer an, dann handelt es sich fast durchweg um Werbung. Man stellt die Wohltaten, die mit einem Projekt oder Plan verbunden sein könnten, dar. Eine unabhängige, sorgfältig abwägende Information ist solche Werbung nicht. Und für die Öffentlichkeit geht das leicht im allgemeinen „Werbe-Rauschen” unter. Das heißt: Schon eine andere Qualität der Information wäre ein sinnvoller Beitrag – sofern eine substanzielle Beteiligung (etwa über das „Ob” einer Maßnahme) nicht mehr möglich sein sollte.
Womit der zweite Aspekt angesprochen ist: Es gibt zweifellos Projekte, deren Vorbereitung und Durchführung sich über (sehr) lange Zeiträume hinziehen. Da kann man nicht in jeder Stufe die grundsätzliche Frage nach dem „Ob” auf‘s Neue stellen. Aber man kann die Beteiligung, so man sie ernst meint, auch nicht irgendwann abschließen und dann über Jahre hinaus davon ausgehen, alles sei besprochen und jetzt gehe es nur mehr um „Umsetzung”. Letztlich darf die Kommunikation, dürfen Information und Dialog über ein Vorhaben nie abreißen. Sie werden jedoch in jeder Etappe neu auszurichten sein – und dabei stets transparent halten müssen, wie der bisherige Gang der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung verlief. Das ist aufwändig – zweifellos. Aber es bedarf auch dazu in erster Linie nicht neuer Verfahren. Sondern einer anderen politischen Kultur. Eben: Basta mit Basta.
Autor: Klaus Selle, Professor am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen; Mitwirkung an der Gestaltung kommunikativer Prozesse der Stadtentwicklung im Rahmen von Netzwerk Stadt | Forschung, Beratung, Kommunikation
PDF anzeigenBürgerbeteiligung per Volksentscheid in Appenzell. Foto: H.D. Zimmermann (CC)
Partizipation
Der Begriff der Partizipation benennt die Hoffnung der Menschen auf Partnerschaft im Entscheidungsprozess wie auch den Unwillen, sich mit einer festgelegten Rolle zufriedenzugeben – so formuliert es der Club of Rome in seiner Studie „Zukunft und Lernen“ und schreibt weiter: „Effektive Partizipation setzt das Streben des Menschen nach Integrität und Würde voraus sowie seine Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Obwohl das Recht zu partizipieren garantiert werden kann, können weder die Partizipation selbst noch die damit verbundene Pflicht und Verantwortung‚gegeben’ oder weggegeben werden. Echte Partizipation vollzieht sich freiwillig“ (Club of Rome 1979, S. 58 f.).
Wenn von Partizipation die Rede ist, geht es also um die verantwortliche Beteiligung der Betroffenen an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart und Zukunft. Diese kann sich sowohl auf politische Prozesse als auch um die Gestaltung des sozialen Nahraums beziehen. Wenn Partizipation auf die Beteiligung an politischen Prozessen zielt, dann geht es um Mitwirkung an Entscheidungen, die
a) Öffentlichkeitscharakter haben,
b) Beteiligung an Macht bedeuten,
c) über die kleine sichtbare Bezugsgruppe hinaus Wirkung zeigen,
d) und für die es Kontroversen und Mut braucht.

Mitbestimmung
Anders als der umfassende Begriff der Partizipation bezeichnet Mitbestimmung die Einflussmöglichkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Entscheidungen in ihrem Betrieb oder Unternehmen. Diese sind in den meisten Mitgliedstaaten der EU gesetzlich geregelt; beispielsweise stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem Mitbestimmungsurteil vom 1. März 1979 fest: Die Unternehmensmitbestimmung „hat die Aufgabe, die mit der Unterordnung der Arbeitnehmer unter fremde Leitungs- und Organisationsgewalt in größeren Unternehmen verbundene Fremdbestimmung durch die institutionelle Beteiligung an den unternehmerischen Entscheidungen zu mildern und die ökonomische Legitimation der Unternehmensleitung durch eine soziale zu ergänzen“.
Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen hat sich historisch Prozess aus vielfältigen Motiven und Zielsetzungen heraus entwickelt. Im 19. Jahrhundert artikulierte sich die liberale Überzeugung, dass die Arbeitnehmer nicht als Fabrikuntertanen, sondern als gleichberechtigte Bürger behandelt werden sollten und der preußische Staat suchte mit einer „versöhnenden Arbeiterpolitik“ die Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit, insbesondere im Ruhrgebiet, durch Anhörungs- und Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer zu beruhigen. In der Weimarer Republik wurde das Mitbestimmungsrecht in der Verfassung festgeschrieben und heute haben die Gewerkschaften ihre sozialistischen Ziele zugunsten einer Mitbestimmung in Wirtschaft, Gesellschaft und Unternehmen aufgegeben.


Infrastruktur-Großprojekte und Ökologie
Infrastruktur-Großprojekte, z.B. die Erstellung von Verkehrsstrecken oder Rohrleitungen, nehmen große Flächen ein. Sie greifen nicht nur in Lebens- und Wirtschaftsräume ein, sondern gleichermaßen in bestehende Ökosysteme. Dabei hängt der Zustand der Ökosysteme nicht nur von ihren natürlichen Eigenschaften ab, sondern auch von den Einwirkungen bei der Realisation der Infrastrukturprojekte. Die Berücksichtigung ökologischer Komponenten bei der Realisation der Infrastruktur-Großprojekte ist erforderlich, um eine Verschlechterung der Umwelt- und Lebensraumqualität zu vermeiden.
Das Infrastruktur-Großprojekt Emscherumbau realisiert mit einer Gesamtinvestition von 4,4 Mrd. Euro bis 2020 den Bau neuer Kläranlagen und unterirdischer Kanäle auf einer Länge von 400 Kilometern und nimmt zudem die naturnahe Umgestaltung der Gewässer vor. Heute sind neben 4 Kläranlagen schon 230 Kilometer Abwasserkanäle gebaut und 103 Kilometer Wasserläufe umgestaltet.

Inhaltsverzeichnis
- Das Ruhrgebiet als kulturelles Erbe
- Vom "Change!" zur Veränderung
- Das digitale Desaster der Erinnerung
- Transformationen der Wahrnehmung von (urbanen) Landschaften
- Interdisziplinäre Metropolenforschung
- Infrastrukturprojekte und Bürgerbeteiligung <<
- Nachhaltige Entwicklung
- An Herausforderungen wachsen
- Vom Geldgeber zum Mitgestalter
- Transparenz ist kein Gespenst
- Wasser als Wirtschaftsgut
- Sich Die Welt Zu Eigen Machen
- Wie noch nie. Neue Altersbilder am neuen Fluss
- Wasserpolitik im Privathaushalt
- Das Genossenschaftsprinzip als "role model"
- Plakative Kommunikation
- Partizipative Stadtteilarbeit
- Spannungsfelder
- Politische Modernisierung durch Medien?
Wissenswertes

Mehr lesen
Die in diesem Text angesprochenen Themen werden ausführlicher behandelt in: Klaus Selle (2013): Über Bürgerbeteiligung hinaus. Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe? Analysen und Konzepte. edition stadt|entwicklung. Detmold (Verlag Dorothea Rohn).
Vom Dialog zum Masterplan
Mit der Gestaltung des neuen Emschertals treibt die Emschergenossenschaft nicht nur eines der größten wasserwirtschaftlichen Umbauprojekte voran, sie gestaltet das Gesicht der Region neu. Ein derartiger Transformationsprozess kann nur unter Einbeziehung der Öffentlichkeit funktionieren. So haben schon im Vorfeld des eigentlichen Masterplans „Emscher-Zukunft“ zahlreiche öffentliche Großveranstaltungen und allein 150 Einzelgespräche in Gemeinden und mit Interessengruppen stattgefunden. In diesen „Emscherdialogen“ diskutierten die Teilnehmer die vielfältigen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten des Emscher-Umbaus.
Aber auch die Umsetzung des Masterplans wird von Veranstaltungen begleitet, die dem Wandel eine greifbare Form geben und Möglichkeiten zur Partizipation bieten. Unter dem Stichwort „Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ ist Mitmachen gefragt: ob im Fotoprojekt Emscher-Zukunft, in den Emscherexpeditionen, Musik und Performancekunst im Pumpwerk oder der Zauberwelt Wasser .

Formen der Beteiligung
Partizipation kann auf verschiedenen Ebenen und durch vielfältige Methoden realisiert werden. So gibt es etwa projektbezogene Formen, die bei überschaubaren Problemstellungen und konkrete Planungsvorhaben angewendet werden können, z.B. bei Stadtteilfesten oder Tagen der Begegnung. Offene Formen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Meinungsäußerung der Bevölkerung im Zentrum steht. Dazu zählen etwa Gespräche, Umfragen, Diskussionen, Studien und Vereinbarungen. Es gibt keine Verpflichtung zur Regelmäßigkeit. Parlamentarische Formen sind durch Kontinuität und formale Strukturen gekennzeichnet und haben in der Regel eine rechtliche Grundlage, wie z.B. die Möglichkeit des Volksentscheids. (Literaturhinweis: "Emscher 3.0", S. 168, Verlag Kettler, ISBN: 978-3-86206-244-7)
Jeweils angewendet werden können z.B. einfache Methoden, die auf einen Teilaspekt von Partizipation abzielen, z.B. Methoden zur Ideen- oder Problemlösungsfindung; komplexe Methoden, die ganzheitlich oder in Kombination mit Einzeltechniken eingesetzt werden, z.B. Zukunftswerkstätten, Metaplantechnik; inhaltlich strukturierte Methoden, die unterstützend in einzelnen Projektphasen zur Anwendung kommen, z.B. Präsentationstechniken, Interventionen/Spiele, die in Klein- oder Großgruppen, phasen- oder situationsbezogen oder eingebettet in ein Gesamtkonzept Wirkung entfalten.
Werkstattverfahren
Bei der Planung des größten neuen Pumpwerks der Emschergenossenschaft im Oberhausener Stadtteil Biefang bediente man sich eines kooperativen Verfahrens, über das Ideen und Konzepte für die Gestaltung gefunden werden sollten. Nachdem die Planungen des tiefbaulichen und technischen Bereichs abgeschlossen waren, galt es in einem weiteren Schritt zu diskutieren, wie die Architektur und die landschaftliche Einbindung des Pumpwerks ausgestaltet werden sollte. Die Emschergenossenschaft führte hierzu eine Gestaltungswerkstatt durch. Dieses Verfahren bot Vertretern der Bürgerschaft, der Stadt Oberhausen sowie der Politik die Möglichkeit, ihre Anregungen in den laufenden Entwurfsprozess einzuspeisen und damit unmittelbar Einfluss auf die zukünftige Gestaltung des neuen Pumpwerks zu nehmen. Download Dokumentation der Gestaltungswerkstatt
Um sich aktiv an der Sammlung von Ideen und Anregungen zu beteiligen, waren allein zur Auftaktveranstaltung ca. 120 Bürgerinnen und Bürger gekommen. Neben der Klärung wesentlicher Fragen zur Planung und zum Bau des Pumpwerks konnten so einige Anforderungen an die zukünftige Gestaltung des Bauwerks aufgenommen werden, welche den Planungsteams für den weiteren Entwurfsprozess mit auf den Weg gegeben wurden.