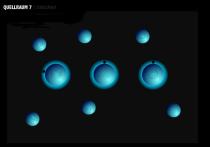EMSCHERplayer // Magazin // Heimat und Lebenswelten // Armut in der Emscherzone
Armut in der Emscherzone
Möglichkeiten stadtplanerischer Intervention
 01
01
Das Ruhrgebiet und insbesondere seine Emscherzone leiden schon seit Längerem und überdurchschnittlich unter nicht nur leeren öffentlichen, sondern nun auch zunehmend unter leeren privaten Kassen, und beides ist im städtischen Raum immer stärker sichtbar. Die Armut hat sich verfestigt und räumlich konzentriert. Sie führt in immer mehr Stadtteilen zu einer Abwärtsspirale, die durch neue Wege in Planung und Politik gestoppt werden muss.
Drei Tendenzen, eine Wirkung
In den Stadtteilen mit Abwärtsspirale wirken drei sich überlagernde negative Tendenzen:
1. die Verarmung privater Haushalte durch zunehmende Arbeitslosigkeit und einem damit verbundenen sozialen Abstieg,
2. die steigende Schuldenlast der öffentlichen Haushalte und eine damit verbundene Einschränkung öffentlicher Mittel,
3. die immer noch anhaltende strukturelle Krise der Region, die wiederum die regionalen öffentlichen Haushalte überdurchschnittlich belastet.
Armut und soziale Deprivation zeigen sich weniger am materiellen Zustand des öffentlichen Raumes, sondern lassen sich vor allem an der Art und Weise erkennen, wie die Bewohner der betroffenen Viertel mit ihrem Stadtteil umgehen, was wiederum wesentlich damit zusammen hängt, wie sie miteinander umgehen. Beides zusammen sorgt dafür, dass sich diese Stadtteile sozialräumlich isolieren und die noch verbliebene Mittelschicht, ja überhaupt die, die noch in ‚Lohn und Brot’ stehen, aus ihnen kontinuierlich abwandern.
Diese Abstiegsproblematik ist im Emschertal ethnisch akzentuiert, denn die Arbeitslosigkeit hat in den letzten Jahrzehnten auch die ausländische Bevölkerung und hier besonders die Jugendlichen betroffen. Deren Familien hatten sich jedoch schon vorher, ethnische Nähe und Vertrautheit suchend, in den benachteiligten Stadtteilen der Region konzentriert. Die Wenigen aber, die es in der zweiten und dritten Generation in die Mittel- und Oberschicht geschafft haben, verhalten sich in problematisch werdenden Stadtteilen zunehmend ähnlich wie die deutsche Mittelschicht: Auch sie verlassen sie.
Zurück bleiben die Menschen, die aus finanziellen oder sozialen Gründen nicht weg können, was das Zusammenleben zwischen den verbleibenden Deutschen und Ausländern in diesen Quartieren keineswegs einfacher macht. Menschen, die ihre Perspektive verloren haben, verlieren auch an Selbstsicherheit und -gewissheit und damit zumeist auch ihre Toleranz- und Dialogpotenziale. Die gemeinsame Armut hat dadurch trotz objektiver Ähnlichkeit der Ausgangslage subjektiv häufig mehr Trennendes als Verbindendes.
Was Planung gegen Armut tun kann
Kommunale Planung ist auf Grund ihrer Abhängigkeit von überlokalen Entscheidungen nicht in der Lage, aus sich heraus die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen der Armut zu beheben. Sie hat diesbezüglich auch keine Steuerungsfunktion wie z.B. die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Sie kann allerdings bei entsprechendem politischen Willen und materiellem Einsatz die Armut für die Betroffenen mildern, deren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt indirekt erleichtern und ihre räumliche Ballung aufbrechen bzw. die Entstehung und Ausbreitung von Armutsghettos verhindern. Und zwar durch:
· Arbeitsmarktsbestandspflege und Förderung der lokalen Wirtschaft
Durch vorausschauende und begleitende Flächen- und Infrastrukturmaßnahmen kann der lokale/regionale Arbeitsmarkt gestärkt werden. Die Bestandspflege ist im Ruhrgebiet dabei insgesamt erfolgversprechender als die Ansiedlungsbemühungen von Neubetrieben, die häufig nur Standortverlagerungen innerhalb der Region sind. Insbesondere müssen die ethnischen Ökonomien, d.h. in der Emscherzone vorrangig türkischen Betriebsgründungen in den diesbezüglichen Stadtteilen gefördert werden.
· Schutz und Förderung des preiswerten/billigen Wohnraumes
Preiswerter Wohnraum, ja sogar billige Wohnflächen im untersten Standardbereich sind Rettungsanker für von Armut betroffene Familien und Einzelpersonen, weil sie auch dann noch bezahlbar bleiben, wenn das Einkommen sinkt, ja für kurze Zeit sogar ganz ausfällt. Sie entlasten aber auch den Sozialhilfehaushalt der Kommunen und ermöglichen es vor allem kinderreichen Armen, dem durch die Reduzierung des Wohnraumes verursachten zusätzlichen innerfamiliären Konfliktpotenzial zu entgehen.
· Förderung des ÖNVs und des Fahrradverkehrs
Die systematische Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Fahrrades vergrößert neben den stadtökologischen Effekten vor allem auch die Mobilität der Bevölkerung, die sich auf Grund von Verarmung keinen PKW-Besitz leisten kann. Hohe und preiswerte Mobilität erleichtert aber nicht nur die gesellschaftliche Teilhabe der Armen, sondern auch die alltägliche Versorgung und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
· Förderung und Pflege stadtteilorientierter sozialer Durchmischung und Urbanität
Stadtteilorientierte Nahversorgung und öffentliche Aufenthaltsqualität stabilisieren die soziale Struktur verarmungsgefährdeter Stadtteile. Dazu gehört die Pflege des äußeren Erscheinungsbildes, d.h. vor allem die systematische Verhinderung von Vandalismus und Verdreckung des öffentlichen Raums. Im Zusammenhang mit der Verhinderung der Mittelschichtsabwanderung sollte auch für die ausländische Mittelschicht solcher Stadtteile – also im Emschergebiet vor allem die türkische – deren Wohnungseigentumsbildung gefördert werden.
· Aufbau gemeinschaftsfördernder Infrastrukturen in ghettoisierten Stadtteilen
In Stadtteilen mit hoher Armut können neben den bereits vorhandenen öffentlichen Einrichtungen zusätzlich ehrenamtlich betriebene Suppenküchen, Wärmestuben, Betreuungs- und Aufenthaltsflächen für Kinder, auch nachts benutzbare Sportstätten für Jugendliche, pädagogisch betreute Treffpunkte für Computer-Kids die soziale Verrohung verhindern und den Zusammenhalt der Bewohner stärken.
· Schaffung sozialer Treffpunkte und Aufenthaltsnischen für verarmte Bevölkerungsgruppen in zentralen Stadtlagen
Arme und anderweitige sozial deklassierte Menschen haben als letzten sozialen Anker häufig nur noch die, die in einer ähnlichen Lage wie sie selbst sind. Diese wohnen jedoch nicht immer in unmittelbarer Nähe und so entstehen an zentralen und mit dem ÖNV oder Zweirad gut erreichbaren Stellen Treffpunkte, an denen Menschen auch häufig ganztägig zusammen sind. Solche Aufenthaltsorte haben eine hohe innere und äußere Konfliktträchtigkeit, aber sie stellen auch Orte der Kommunikation und Begegnung dar und müssen als solche erhalten bleiben und durch Zusatzangebote ergänzt und erweitert werden.
Mehr Gemeinwesen und mehr Toleranz
Eine funktionierende Armutsbekämpfung setzt ein funktionierendes Gemeinwesen voraus, um die Konflikte bewältigen zu können. Die Gemeinwesenarbeitsansätze, die beim „Programm für die Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ Eingang in die Stadtplanung gefunden haben, sind von daher nur folgerichtig. Sie müssen zudem dringend durch die Einführung des kommunalen Ausländerwahlrechts ergänzt und fundiert werden, sonst bleibt die Rede von der ethnischen Integration hohl und leer.
Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht darüber hinaus die Toleranz aller Beteiligten, insbesondere aber die der Mehrheitsgesellschaft. Toleranz ist nicht zuletzt bei genau den sozialräumlichen Konflikten erforderlich, die sich beim Erhalt der oben genannten zentralen Treffpunkte der Verarmten und sozial Deklassierten manifestieren. Hier kommen die staatlichen Behörden auf Grund der häufig alkoholisierten oder sonstig drogenabhängigen Klientel solcher öffentlichen Aufenthaltsbereiche trotz entsprechender helfender Betreuung ohne gleichzeitig härtere Ordnungs- und Kontrollmaßnahmen nicht aus. Trotzdem müssen solche Nischen stadträumlich nach dem Prinzip der kontrollierten Duldung auf Dauer gestellt werden. Sie müssen aber auch räumlich so positioniert werden, dass der sozialräumliche Konflikt für alle Beteiligten erträglich verlaufen und von ihnen gestaltet werden kann. Dafür wäre es hilfreich in Erfahrung zu bringen, wie genau die Bedürfnisse der Gruppen aussehen, die den öffentlichen Raum mehr oder weniger unkonventionell benutzen und welche Störpotenziale für den nachbarschaftlichen Frieden damit verbunden sein können. Entsprechende Untersuchungen in Auftrag zu geben, ist Bestandteil des Gemeinwesens.
Zu einem toleranten Gemeinwesen gehört es auch, einige Formen ethnisch/kultureller Abgrenzungen und darauf bezogener kleinteiliger Geschlossenheiten (Häuser, Baublöcke oder sogar ganze Straßenzüge) als unvermeidlich anzusehen statt sie in Entsprechung der landläufigen Expertenmeinungen stetig anzuprangen. Im Gegenteil kann gezeigt werden, dass ethnisch einheitliche Areale, sofern sie nicht zu groß werden, für das Zusammenleben im Stadtteil sogar von Vorteil sind; sie bieten nämlich den sozial Geschwächten einen zusätzlichen, persönlichen Halt. Sie bilden eine soziale Basis, auf der Kompromisse und Zumutungen innerhalb des Stadtteils leichter bewältigt werden können. Sie sind in der Lage, Identitäten zu sichern und interkulturelle Kommunikation und Solidarität zu fördern, sofern ihre äußere und innere Abgeschlossenheit durchlässig ist und es dort genug Menschen gibt, die sozial und kulturell den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft haben.
Gegen die Rede von der „Parallelgesellschaft“
Die Vorstellung von flächendeckender ethnischer und/oder sozialer Durchmischung gibt es, genau genommen, sowieso nur in Ausnahmefällen. Stattdessen taucht sie aber immer wieder als sozialpolitische Wunschvorstellung zur Alternative des Ghettos auf. Unter dem Stichwort „Parallelgesellschaft“ wird hier die Abwendung von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft und die kulturelle Abgeschlossenheit ethnisch homogener Stadtteile oder Viertel betont. Solche Einschätzungen bleiben jedoch an der Oberfläche, ja verdichten sich zu gut gepflegten Vorurteilen, solange die psychischen, sozialen und ökonomischen Funktionen dieser städtischen Untersysteme nicht näher betrachtet werden. Diese sind :
· Die kulturelle Auffang- und Rückzugsfunktion. Sie ist vor allem für die Abfederung und Überwindung der Fremdheitserfahrung wichtig, die mit jeder Migration unausweichlich verbunden ist und die ohne Weiteres mehr als eine Generation anhalten kann.
· Die nachbarschaftliche Unterstützungsfunktion. Sie bildet als gegenseitige Hilfe zur Selbsthilfe eine Tradition aus, die in den Herkunftsländern der Migranten oft üblich und für das Einwanderungsland respektive die Einwanderungsstadt als Gewinn betrachtet werden kann.
· Die sozioökonomische Aufstiegsfunktion. Die Erfahrung von fünfzig Jahren Einwanderung zeigt, dass ethnische Netzwerke und Familienverbände die Basis, eine erste Stufe zu sozialer und ökonomischer Mobilität darstellen.
· Die psychologische Selbstvergewisserungsfunktion. Die Integration und/oder die kulturelle Anpassung setzt, wenn sie dauerhaft sein soll, eine individuelle, das heißt partiell von der eigenen ethnischen Gemeinschaft unabhängige Entscheidung voraus. Diese Individuation gelingt aber nur auf Basis einer Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Herkunft und Besonderheit.
Diese Funktionen-Vielfalt von ethnisch homogenen Wohnvierteln kann produktiv werden, muss aber nicht. Gleichermaßen ist auch die selbst gewählte Segregation möglich, sprich das bewusste Bleiben im Ghetto, was dieses für den Betreffenden dann zur „Enklave“ macht. Enklaven aber, daran sei hier erinnert, gibt es auch in der Mehrheitsgesellschaft massenhaft. Die meisten Menschen wohnen, wenn sie sozial und vor allem finanziell frei entscheiden können, statistisch flächendeckend nachgewiesen, eher mit denen zusammen, die soziokulturell und ökonomisch zu ihnen passen.
Armut, leere Kassen und Kreativität
Leere Kassen erzwingen andere Ansätze von Planung und Gestaltung und auch andere Standards ihrer Ausführung. Mit weniger Mitteln mehr, zumindest aber nicht weniger zu erreichen, sollte dabei das gesellschaftliche Ziel sein. Das gilt nicht nur für die Manpower der Verwaltung, sondern vor allem für die Leistungs- und Ausstattungsstandards öffentlicher Anlagen und Einrichtungen. Damit einhergehen muss eine intensive Diskussion über das, was wirklich gebraucht wird, was die Mindestansprüche an eine öffentliche Versorgung sind und was aus eigener Kraft und in Nachbarschaftshilfe selbst hergestellt bzw. gewährleistet werden kann. Der wesentliche Motor zur Bekämpfung von Armut unter den Bedingungen leerer Kassen ist ein neuer innovativer Umgang mit knappen Mitteln und die Stärkung und Förderung von Menschen statt Gebäuden. Die eigentliche Kraft der Veränderung kommt dabei nur im Ausnahmefall aus den üblichen und etablierten Gruppen- und Organisationszusammenhängen politischer, sozialer oder kultureller Art. Wenn diese nämlich funktionieren würden bzw. die realen Probleme der Stadtteilbewohner aktiv repräsentierten, bedürfte es entweder überhaupt keines staatlichen Programms oder die Alarmglocken zu seinem Einsatz hätten viel früher und lauter geklingelt.
Es geht jetzt vor allem darum, all die Einzelpersonen zu entdecken, die sowohl Ideen – und seien sie noch so verrückt – als auch die Kraft und die Motivation haben, sie umzusetzen. Es ist durchaus möglich, dass sich unter dieser Personengruppe auch Mitglieder der etablierten Stadtteilorganisation befinden, aber diese Zugehörigkeit kann weder Leitlinie der Suche noch Kriterium ihrer Auswahl sein. Ausgangspunkte des Erneuerungsprozesses sind vielmehr die Ideen, die sie tragenden Menschen und ihr fester Wille am Ort zu bleiben, unabhängig davon, ob die Personen und das, was sie tun wollen, in bestimmte Förderrichtlinien passen. Vielmehr haben sich umgekehrt die Förderrichtlinien ihnen anzupassen. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Kriterien der Bewertung für diese Ideen geben sollte, denn diese müssen sich am Ziel orientieren: die Armut und die damit verbundene Selbstaufgabe eines Quartiers zu bekämpfen. Wer jedoch was zur Erreichung dieses Ziels beitragen kann, sollte nicht vorab und unabhängig von den jeweiligen besonderen Bedingungen festgelegt werden. Es muss zuallererst mit denen besprochen werden, die sich so etwas auch selbst zutrauen.
Individuelle und kollektive Kreativität sind die Ressourcen, die in der Regel wenig kosten und zugleich zu erheblicher Kosten-Ersparnis führen können. Sie setzen allerdings voraus, dass in den betroffenen Stadtteilen eine Bildungsoffensive mit allen anderen aufgezeigten Wegen Hand in Hand gehen. Wer das Geld für diese Offensive nicht ausgeben will bzw. wer nicht bereit ist, dafür an anderen Maßnahmen und Ausgaben zu sparen, der hat den Kampf sowohl gegen die leeren Kassen als auch gegen die Armut von Anfang an verloren. Die neuerdings so viel genannten Kreativquartiere müssen in der Emscherzone vor allem die Kindergärten sein. Dort liegt und spielt die Zukunft des neuen Emschertals und seinen ökonomischen, kulturellen und sozialen Erfolgen.
Autor: Dr. Arnold Voß, geb. 1949, ist Inhaber des Planungsbüros „Office for the Art of Planning-OfAP“ mit Sitz in Bochum und Berlin. Hier ist er als Berater und Gutachter für Politik/Verwaltung, Bürgerinitiativen und private Investoren tätig.
PDF anzeigenFotos: Erich Ferdinand (flickr.com)
Europäisches Jahr 2010
Das Europäische Jahr 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung hatte die Zielsetzung, das öffentliche Bewusstsein für die Risiken von Armut und sozialer Ausgrenzung zu stärken und die Wahrnehmung für ihre vielfältigen Ursachen und Auswirkungen zu schärfen. Mit diesem von der Europäischen Kommission ausgerufenen Jahr sollte den Vorurteilen und möglichen Diskriminierungen gegenüber von Armutsrisiken und Ausgrenzung betroffenen Menschen begegnet werden. Gleichzeitig sollten Ansätze zu deren Überwindung aufgezeigt werden. Öffentlichkeit und Politik sollten mit diesem Aktionsjahr für mehr Engagement gewonnen werden. Die Arbeit der Wohlfahrtsverbände, der unabhängigen Betroffenenverbände und die Initiativen freier Träger sollten Anerkennung und nachhaltige Stärkung erfahren. Zusätzlich wurden Unternehmen ermutigt, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich freiwillig gesellschaftlich zu engagieren. Die Abschlussveranstaltung Anfang Dezember fand in dem Bundesland statt, in dem auch die meisten Projekte realisiert wurden: in NRW.
Soziale Stadtteilprogramme
Das Städtebauförderungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und der Länder wurde im Jahr 1999 mit dem Ziel gestartet, die „Abwärtsspirale“ in benachteiligten Stadtteilen aufzuhalten und die Lebensbedingungen vor Ort umfassend zu verbessern. Die Soziale Stadt startete im Jahr 1999 mit 161 Stadtteilen in 124 Gemeinden. Die durch komplexe Problemlagen in den Bereichen Städtebau und Umwelt, infrastrukturelle Ausstattung, lokale Ökonomie, Soziales, Integration und nachbarschaftliches Zusammenleben sowie Imagebildung charakterisierten Stadtteile werden mit einem integrierten Ansatz der umfassenden Quartiersentwicklung unterstützt. Die Finanzierung des Programms erfolgt gemeinsam durch Bund, Länder und Kommunen. Die besten diesjährigen Projekte werden im Januar 2011 vom Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. mit dem Preis "Soziale Stadt 2010" ausgezeichnet. Mehr Informationen auf www.sozialestadt.de, lokale Projekte unter www.soziale-stadt.nrw.de.
Allen Erfolgen zum Trotz sieht die Zukunft für das Programm „Soziale Stadt“ bundesweit düster aus: Im November wurde eine Kürzung der Mittel um 70% beschlossen, das heißt: Standen im laufenden Jahr 95 Mio. Euro Bundesmittel für das Programm zur Verfügung, so sollen es 2011 nur noch 28,5 Mio. Euro sein.

Sozialer Wohnungsbau
Rund eine Milliarde Euro wurden 2010 vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW für den sozialen Wohnungsbau reserviert. Außerdem wurden Räume für die wohnungsnahe soziale Infrastruktur und Projekte, die sich aus kommunalen Handlungskonzepten für das Wohnen ableiten, gefördert. Der Hauptteil der Wohnraumförderung wird aus Mitteln der NRW.Bank finanziert, der Rest sind Kompensationszahlungen aus dem Bundeshaushalt, die den Ländern durch die Föderalismusreform zustehen.
Mobilität I: Sozialticket
Als erster Verkehrsverbund in Deutschland soll der VRR ein Sozialticket bekommen. Darauf haben sich im Oktober SPD, CDU und Grüne geeinigt. Das Ticket soll 22,50€ kosten und eine Gültigkeit der Preisstufe A, also einem Tarifgebiet entsprechend, besitzen. Die bundesweite Einführung wird, sofern die finanziellen Rahmenbedingungen mit dem Land geklärt sind, zum 1. Juni 2011 erfolgen. Eine Arbeitsgruppe wird sich in der Zwischenzeit damit befassen, sicherzustellen, dass die Einführung des Sozialtickets für die Städte und Kreise im Verbundraum kostenneutral bleibt und es zu keiner zusätzlichen Belastung der kommunalen Haushalte, der Verkehrsunternehmen sowie anderer Nutzergruppen kommt.
Mobilität II: Fahrradfahren für alle
Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat verschiedene Mobilitätsangebote im Programm: „bikey“ richtet sich an Fahrgäste der Bahn, die mit dem Rad zum Bahnhof fahren wollen oder am Zielort ein Fahrrad nutzen möchten. Während die bikey-Fahrräder jedoch nur an fünf Stationen im Ruhrgebiet geliehen und abgegeben werden können, bietet das „Metropolrad Ruhr“ ein umfangreicheres Angebot an Leihfahrrädern und Radstationen. Die Nutzungszeit bei beiden Leihfahrrädern wird elektronisch erfasst und damit exakt abgerechnet - sei es stunden-, tages-, monats- oder jahresbezogen. Mehr Informationen zu den Mobilitätsangeboten des VRR auf www.vrr.de.


Parallelgesellschaft
Die vermeintliche Entwicklung von „Parallelgesellschaften“ in Deutschland ist seit 2004 das am häufigsten vorgebrachte Argument für die Auffassung, dass die Integration von Zuwanderern in der Bundesrepublik misslungen sei. Dabei gilt der Islam als Ursache oder Merkmal gesellschaftlicher Desintegration. Die Rede von der „Parallelgesellschaft“ als Konzept zur Beschreibung der Zuwanderungswirklichkeit erfuhr aber auch öffentliche Kritik. Ihre Kritiker argumentierten, die Behauptung der Existenz von Parallelgesellschaften diene in erster Linie dem Ziel der Abqualifizierung gesellschaftlicher Pluralität.
Vgl. z. B.: Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung
Ghetto oder Szeneviertel?
Friedrichshain/Kreuzberg ist ein ehemaliges Arbeiterviertel, der Berliner Stadtteil mit der zweithöchsten Kriminalitätsrate und es leben überdurchschnittlich viele Migranten im Viertel. Typische Merkmale für ein „Ghetto“? In diesem Fall nicht, denn das Quartier mit den zahlreichen Bars, Kinos und sozialen Einrichtungen gilt als Szeneviertel, das nicht nur Touristen und Studenten anzieht, sondern mit seiner Vielfalt und jungen Altersstruktur auch Unternehmen wie Universal Music und MTV in den Stadtteil lockte. Aber was macht den Unterschied zwischen Ghetto und Szeneviertel aus? Ist es der hohe Anteil an Freizeiteinrichtungen? Die Bevölkerungsstruktur aus Künstlern und Studenten? Oder ist es die räumliche Struktur: Kreuzberg/Friedrichshain lädt mit einem Volkspark und der Lage am Spree-Ufer sicherlich mehr Menschen zum Verweilen ein als Stadtteile mit überwiegend betonierten Flächen. Dazu liegt der Stadtteil zentrumsnah, ist mit dem Nahverkehr schnell zu erreichen. Sicherlich bilden all diese Faktoren zusammen eine günstige Basis für die Entstehung von Szenevierteln. Entscheidend ist aber auch eine hohe Identifikation mit dem eigenen Viertel, die dazu beiträgt, dass sich alle für ihr Quartier verantwortlich fühlen und sich gern engagieren.

Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Anonymität und Heimat
- Aufwertung versus Verdrängung
- Die Neuerfindung des Fahrrads
- Was ist uns die Natur wert?
- Lebenswelt Familie
- Wie zusammen wohnen?
- Pflanzliche Rückkehrer und Zuwanderer
- Macht Stadt krank?
- Neue Parks als Katalysatoren
- Vorreiter der Zivilgesellschaft
- Regionale Gegenwarten
- Die Natur der Anderen
- Erholung, Freizeit und Kultur
- Wasser, Stadt und Urbanität in der Emscherzone
- Heimatzeiten
- Rückkehr der Natur
- Regionale In-Wert-Setzungen
- Energieeffiziente Kühlung im Klimawandel
- Emscher 3.0
- Topographien des Fetts
- Wasserwirtschaft – eine Überlebenstechnologie
- Fußballmetropole Ruhrgebiet
- Der Gestank der Heimat – herrlich eklig!
- Revier ohne Zäune
- Der will nur spielen!
- Armut in der Emscherzone <<
- Lernfeld ‚Fluss’
- Ordnung im Hinterhof
- Wasser und Wasserwirtschaft
- Die Region als Kulisse des Glücks
- Unterwelten
Wissenswertes

Kreativität
Mit dem Begriff der Kreativität ist Neuschöpfung, Erfindung und Problemlösung bezeichnet. Seit den 1960er Jahren arbeiten im Militär, in der Werbung, in der Betriebspsychologie und im Feld der Pädagogik und der Sozialen Arbeit diverse Personen daran, die Kreativität zu steigern und sie produktiv werden zu lassen. Die erste Kreativitätstechnik wurde von Alex F. Osborn, einem Werbeagenturbesitzer, entwickelt und als „brainstorming“ bezeichnet. Neuerdings spricht man auch von „sozialer Kreativität“, bei der es auch darum geht, Sozialbeziehungen und Organisationsformen von Gruppen weiter zu entwickeln und den Möglichkeitssinn, den gedanklichen Spielraum der Gruppenmitglieder zu erweitern.
Kreativwirtschaft als Wachstumsmotor?
Die Kultur- und Kreativwirtschaft könnte sich zu einer wichtigen Branche innerhalb der Gesamtwirtschaft der Metropole Ruhr entwickeln. Zu diesem Ergebnis kam zumindest eine Studie, die im Auftrag der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) von der „empirica Qualitative Marktforschung, Stadt- und Strukturforschung GmbH“ durchgeführt wurde.
Insgesamt ist die Kreativwirtschaft aber schon auf Grund ihres sehr kleinen Anteils an der gesamten regionalen Wertschöpfung noch kaum in der Lage, als neuer Hoffnungsträger für das Ruhrgebiet zu fungieren. Das gilt ebenso für die während der Kulturhauptstadt 2010 in verschiedenen Städten geplanten und initiierten Kreativquartiere. Ihre Erfolge sind, mit wenigen Ausnahmen, mit Skepsis zu betrachten, da sich solche kreativen Cluster nur schwer von oben aus dem Boden stampfen lassen und gerade die Erfolgreichen unter den Kreativen selbst eher klassisch urbane Städte und Viertel bevorzugen: in Deutschland vor allem München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Zur kritischen Betrachtung der Kreativen Klasse und der Kreativen Quartiere im Ruhrgebiet siehe Dr. Arnold Voß: „Vom Sinn und Unsinn der kreativen Klasse und der Kreativquartiere“
Kultur contra Armut
Von 2006 bis 2009 wurde in Bottrop-Boy und Duisburg-Hochfeld das Projekt „Kulturarbeit mit Kindern“ (Ku.Ki) realisiert. Mithilfe eines kultur- und theaterpädagogischen Ansatzes sollte insbesondere bei Kindern aus sozial schwachen Familien sowohl Kreativität als auch soziales Miteinander und eigeninitiatives Handeln gefördert werden. Hintergrund dieses Projekts war unter anderem die Frage, wie verhindert werden kann, dass Kinder in Armut Beziehungen verlieren und in Netzwerke gar nicht eingebunden werden, die für gesellschaftliche Integration und das spätere berufliche Vorankommen unverzichtbar sind. Um diese Kinder möglichst dauerhaft in die bei Ku.Ki entstandenen Netzwerke einzubinden, wurden zeitgleich zum Projekt Verbindungen zu Schulen, Vereinen, Stadtteilbüros und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort geknüpft. In Bottrop werden heute noch Ku.Ki-Nachfolgeprojekte angeboten.
Initiative ergreifen
Unter dem Motto „Bürger machen Stadt“ unterstützt „Initiative ergreifen“ Projekte, die bürgerschaftliches Engagement und Stadterneuerung wirksam miteinander verknüpfen. Das Programm wendet sich an bürgerschaftliche Projektträger, aber auch an Kommunen, die neue Wege in der Kooperation mit ihren Bürgern suchen. Es wird getragen vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das Programm gibt es seit 1996 mit dem Vorläufer bei der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park. Bis Ende 2007 wurden landesweit 60 Projekte in die Realisierung gebracht, ein großer Teil davon ist baulich fertig gestellt und im erfolgreichen bürgerschaftlich getragenen Betrieb. Überblick "Initiative ergreifen"-Projekte
Social Polis
“Social Polis - the Social Platform on Cities and Social Cohesion” ist ein transdisziplinäres, von der EU gefördertes Projekt, das sich den Problemen von Städten hinsichtlich sozialer Exklusion, ökonomischer Polarisierung und verschiedener Formen von Diskriminierung widmet. Social Polis ist eine offene soziale Plattform, auf der Individuen, Gruppen und Organisationen Ideen einbringen und sich austauschen können. Übergeordnetes Ziel ist die Förderung des sozialen Zusammenhalts innerhalb von Städten, beziehungsweise die gemeinsamen Erarbeitung von Strategien, welche an die EU-Kommission weitergegeben werden können. Zum Internetauftritt von Social Polis

Arbeitslosenzahlen
Im November 2010 lag die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet bei 10,9%. Damit liegt das Revier fast 3 Prozentpunkte über dem NRW-Durchschnitt. Doch nicht die Gesamtzahl der Arbeitslosen, sondern ihre Zusammensetzung ist alarmierend: Der Anteil von erwerbslosen Ausländern etwa liegt im Ruhrgebiet bei knapp 25% und fast 40% der Arbeitssuchenden sind Langzeitarbeitslose. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigungen sinkt zugunsten von Teilzeitstellen und knapp 1 Million Menschen gelten als unterbeschäftigt.
Schwindende Mittelschicht
Die Entwicklung, die in den USA und Großbritannien bereits in den letzten Dekaden zu beobachten war, ist nunmehr auch in Deutschland angekommen: Die Mittelschicht, einst die mit Abstand stärkste Bevölkerungsgruppe, schrumpft. In Zahlen ausgedrückt: von 62% im Jahr 2000 auf 54% im Jahr 2006. (Quelle: DIW) Das entspricht einem Rückgang von fünf Millionen Personen. Beunruhigend: der Abgang erfolgt vor allem nach unten, die ehemalige Mittelschicht gleitet ab in einkommensschwächere Segmente. Ein Aufstieg in höhere Einkommensklassen findet zwar ebenfalls statt, doch teilen sich heute weniger Personen größere Einkommensvolumen. So vergrößert sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter, und die Angst der heutigen Durchschnittsverdiener vor dem Abrutschen in Armutsverhältnisse wächst mit. Diese Sorge ist nicht unbegründet, denn der ehemalige Standard der abhängigen Vollzeitbeschäftigung verschwindet zugunsten anderer Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung und (Schein-) Selbstständigkeiten.
Armut in NRW
Nordrhein-Westfalen liegt mit einer Armutsquote von 14,6 zwar im nationalen Mittelfeld, doch die kommunalen Unterschiede sind beträchtlich. Während im Rhein-Sieg-Kreis oder in der Region Münster etwa 12% der Bevölkerung als arm gelten, bewegt sich die Quote in der Region Emscher-Lippe zwischen 16 und 18% (Quelle: Armutsatlas des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands).
Besonders bedenklich ist, dass außerdem von 3,3 Millionen Kindern und Jugendlichen in NRW knapp 800.000 von Armut bedroht sind. Durch die leeren Kassen der Kommunen werden ihnen zusätzlich Chancen genommen, denn gerade die sozialen Angebote fallen häufig zuerst dem Rotstift zum Opfer.